BO Test am 22. Mai 2024
BO-Teststoff für 22.5.2024: S. 196 - 249
Themen
- 196 - 204: Darstellung der Kommunikationsbeziehungen
- 205 - 216: Netzpläne
- 217 - 246: Sollkonzept:
- 218: Buisness Rules
- 224: Techniken zur Entwicklung eines Sollkonzepts
- 234: Auswahl u. Umsetzung eines Sollkonzepts
- 240: Einführung neuer Systeme
- 246: Kontrolle in der Organisation
196 - 204: Darstellung der Kommunikationsbeziehungen
Informationen zur Gestaltung von Kommunikationsbeziehungen:
- Kommunikationszweck: Instruktion, Information, Motivation
- Kommunikationsstruktur: Richtung, Stufen, Gebundenheit
- Kommunikationsform: schriftlich, mündlich, nonverbal
- Kommunikationskanal: Kommunikationsmittel Tipp: Buch anschauen um die Grafiken zu sehen. (S. 198)
Erhebungstechniken
- Beobachtung: Kommunikationsart, Häufigkeit, Dauer
- Messen u. Zählen: automatische Erfassung
- Dokumentenanalyse: Sender, Empfänger, Inhalt, Häufigkeit
Kommunikationstabelle: Wird verwendet um Schwachstellen wie zB. unangemessene Kommunikationsart, nicht aufwandgerechter Zeitaufwand, etc. zu erkennen.
205 - 216: Netzpläne
Dient der:
- Beschreibung
- Planung
- Steuerung
- Überwachung
Veranschaulichung von Prozessen
- Balkendiagramm: Darstellung von Vorgängen und deren Dauer
- Netzpläne: Darstellung von Vorgängen und deren Abhängigkeiten
- Flussdiagramm/Flowchart: festgelegte Abläufe (107 -> Flowchart diagram)
Netzplan:
__________beliebiger Eintrag___________
frühester Start | Code | frühestes Ende
______________Bezeichnung______________
spätester Start | Dauer | spätestes Ende
217 - 246: Sollkonzept
218: Buisness Rules
Buisness Rules:
- Geschäftsregeln:
- Grundsatz:
- Hinweis:
ECAA-Notation:
- E = Event -> ON
- C = Condition -> IF
- A = Action -> DO
- A = Action -> THEN Können auch zu ECA oder EA verkürzt werden.
Entscheidungstabellen
Ermöglichen die lückenlose Erfassung aller Regeln zu einem Ereignis.
- Vorteile: Übersichtlichkeit, Vollständigkeit, Konsistenz
- Nachteile: Komplexität nimmt rasch zu
224: Techniken zur Entwicklung eines Sollkonzepts
Ablauf der IST-Kritik
Problemerkennung: Abweichung von Soll und IST Problemdefinition: Ort, Zeit u. Umfang des Problems beschreiben Problembedeutung: Auswirkungen des Problems (Only big problems matter) Problemursachen: Für die Lösung des Problems brauch man dessen Ursache Prüfung u. Test: Überprüfung der Lösung
Inhalt der Ist-Kritik
- Gründsatzkritik:(Grundlagenanalyse):
- org. Maßnahme notwendig?
- Auswirkung bei Nichtbeachtung?
- Nicht erfüllte Aufgaben für die Zielerreichung?
- Verfahrenskritik: Sind die aktuellen Verfahren fehlerhaft oder unzweckmäßig?
- Umfang der Prüfung: Gesamtanalyse oder Teilanalyse
Techniken zur Entwicklung eines Sollkonzepts
- Konventionelle Technik: eigene Erfahrung, persönliche Information, Suche im Internet...
- Brainstorming: Ideenfindung in Gruppen für Spontane Einfälle. Wichtig: Kritiklosigkeit, Quantität vor Qualität, Kombination und Verbesserung von Ideen. Ablauf: Ideenfindung u. Ideen sortieren u. bewerten.
- Morphologische Analyse: alle möglichen Lösungen werden aufgelistet und bewertet. Bsp.: | Merkmal | Lösung 1 | Lösung 2 | Lösung 3 | |---------|----------|----------|----------| | Merkmal 1 | x | | | | Merkmal 2 | | x | | | Merkmal 3 | | | x |
- Mindmap: Unterstützt die Strukturierung von Gedanken und Visualisierung von Zusammenhängen. (Nachteil: rach zu unübersichtlich, nicht selbsterklärend)
234: Auswahl u. Umsetzung eines Sollkonzepts
Alternativenbewertung
Scoring-Methode:
- Kriterien festlegen
- Kriterien gewichten
- Gewichtete Kriterien berechnen
- Rangfolge
- Entscheidung
Von der Arbeitsanalyse zur Aufgabenanalyse
- Arbeitsanalyse: Teilaufgaben in kleinste Arbeitselemente zerlegen
- Arbeitssynthese: Arbeitselemente zu Teilaufgaben zusammenfassen
- Aufgabensynthese: Teilaufgaben zu Aufgaben zusammenfassen. Dadurch entsteht die organisatorische Aufbaustruktur.
240: Einführung neuer Systeme
Ablauf der Einführung
1. Einführungsmethode festlegen
2. Realisierungsplanung durchführen
3. Ressourcen bereitstellen
4. Informationen aller unmittelbar und mittelbar betroffenen Aktionseinheiten (~ Allen Bescheit geben)
5. Maßnahmen zur Sicherung der laufenden Aufgabenerfüllung festlegen
6. Übernahmephase
Einführungsmethoden
- Totaleinführung:(revolutionäre Methode) Altes System wird abgeschaltet und neues System wird eingeführt.
- Stufenweise Einführung:(evolutionäre Methode) Neues System wird schrittweise eingeführt.
- Paralleleinführung:(evolutionäre Methode) Altes und neues System werden parallel betrieben. (geringstes Risiko)
- Pilotprojekt:(evolutionäre Methode) Neues System wird in einem Teilbereich eingeführt.
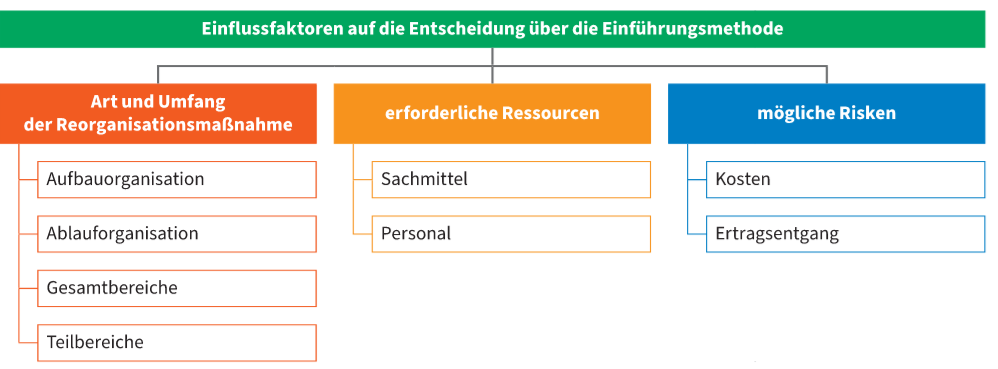
Einflussfaktor Mensch
- Akzeptanz: Wird das neue System akzeptiert?
- Motivation: Sind die Mitarbeiter motiviert?
- Qualifikation: Sind die Mitarbeiter qualifiziert?
- Kommunikation: Wird ausreichend kommuniziert?
Kontrolle in der Organisation
Grundsätze der Kontrolle
Die Kontrolle sollte:
- zeitgerecht,
- lückenlos,
- wirtschaftlich sein.
Funktionen der Kontrolle: - Beobachtungsfunktion
- Beurteilungsfunktion
- Vorsorgefunktion (Abschreckung)
Kontrollprozess:
- Ermittlung der Basisdaten für den Kontrollprozess
- Ermittlung der Realisierungsinformationen
- Ermittlung der Abweichungen
- Abweichungsanalyse
- **Planung der Folgeaktivitäten
Summary
- Kommunikationsbeziehungen werden durch Kommunikationszweck, Kommunikationsstruktur, Kommunikationsform und Kommunikationskanal definiert.
- Netzpläne dienen der Beschreibung, Planung, Steuerung und Überwachung von Prozessen.
- Sollkonzepte werden durch Buisness Rules und Entscheidungstabellen definiert.
- Techniken zur Entwicklung eines Sollkonzepts sind Konventionelle Technik, Brainstorming, Morphologische Analyse und Mindmap.
- Alternativenbewertung erfolgt durch die Scoring-Methode.
- Einführung neuer Systeme erfolgt durch Totaleinführung, Stufenweise Einführung, Paralleleinführung und Pilotprojekt.
- Kontrolle in der Organisation sollte zeitgerecht, lückenlos und wirtschaftlich sein.
- Funktionen der Kontrolle sind Beobachtungsfunktion, Beurteilungsfunktion und Vorsorgefunktion.